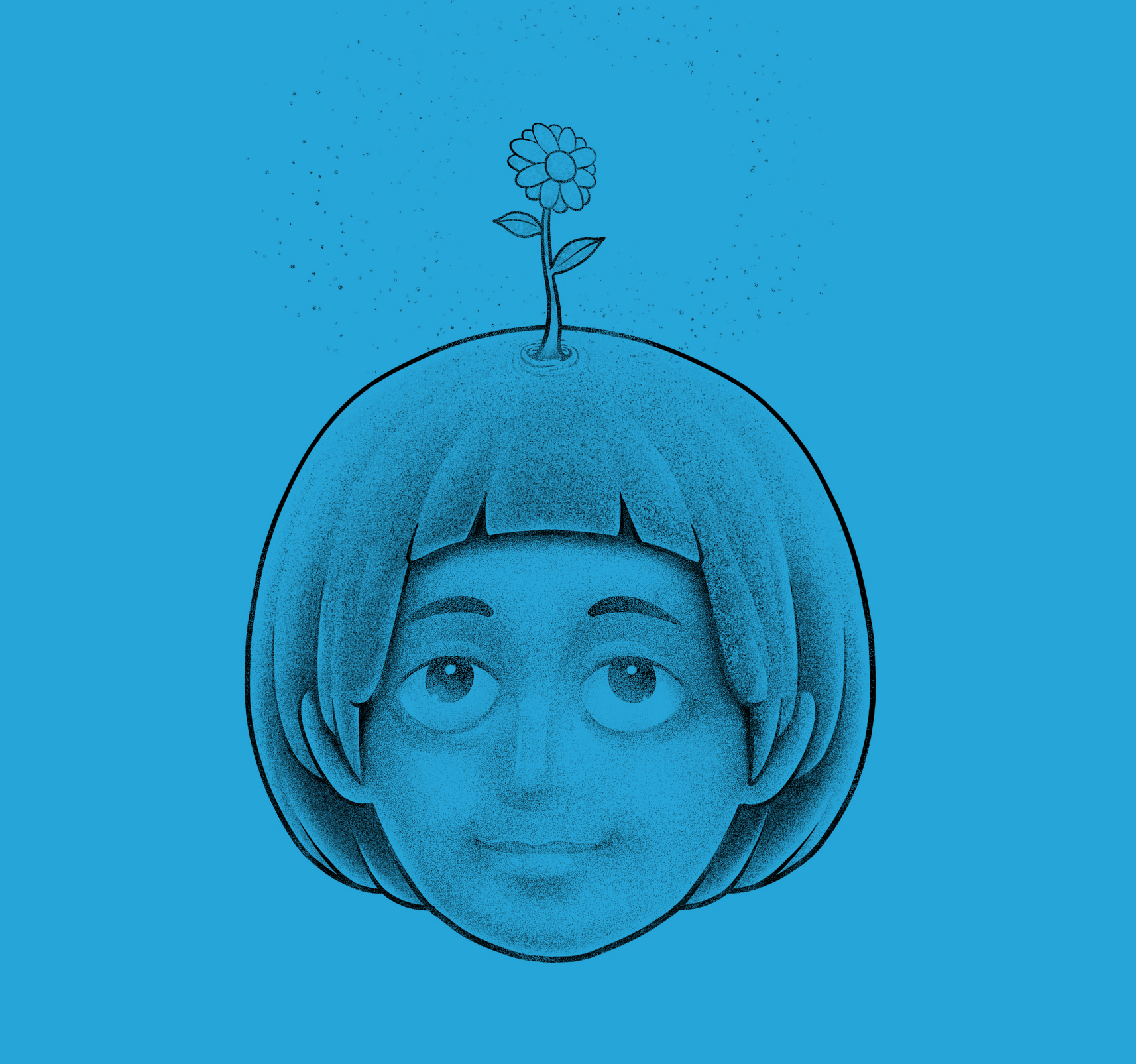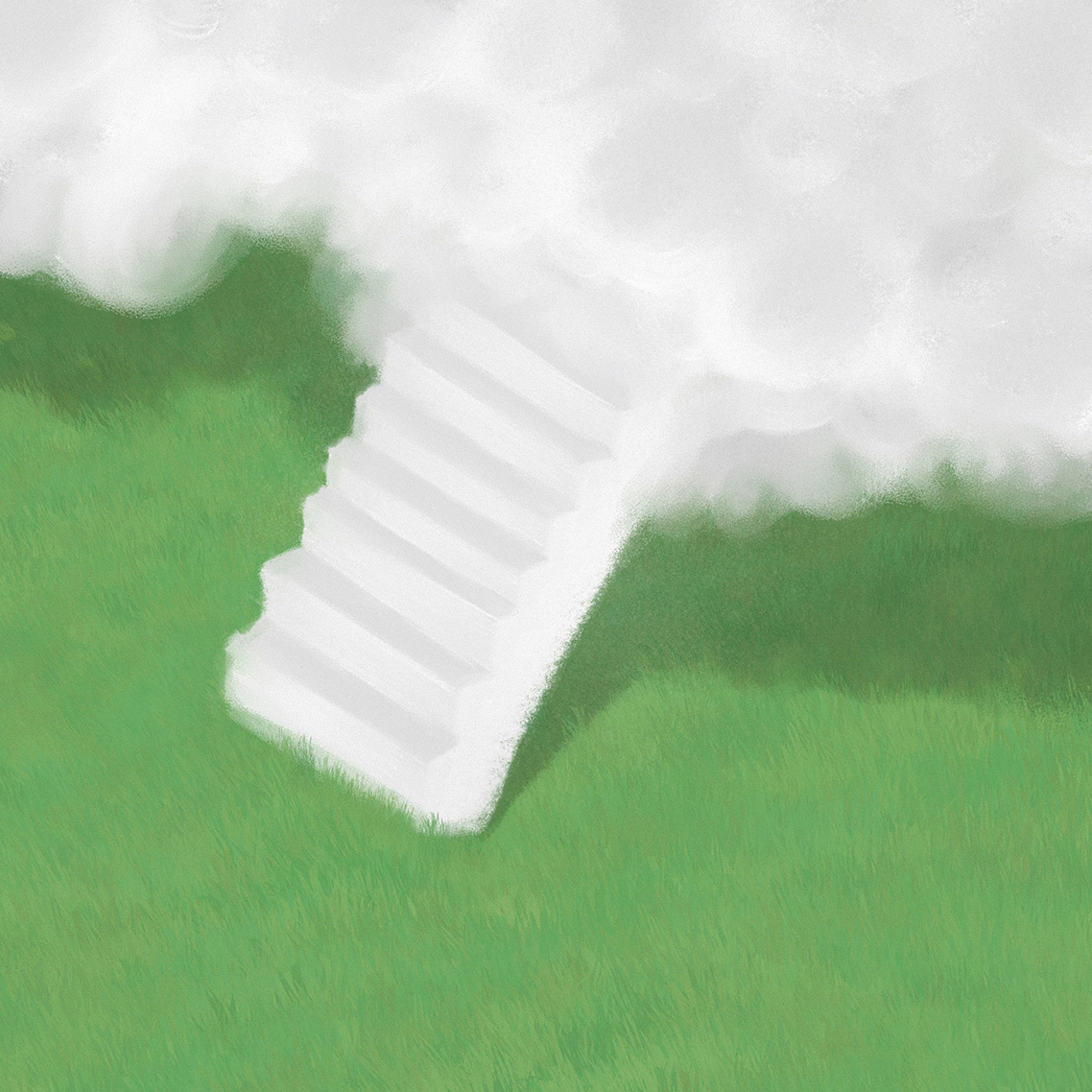Gast-Arbeiterkind
„Wir sind Arbeiterkinder. – Wer ist das nicht? Es müssen doch alle Eltern arbeiten, oder? – Und du?
Ich bin Gast-Arbeiterkind. – Naja, aber irgendwer muss ja auch solche Jobs machen, oder?“
Ich bin die dritte Tochter von vier. In eine Arbeiterfamilie geboren war ich es gewöhnt, aber nahm es nur freudlos hin, dass ich die Kleidung meiner älteren Schwestern auftrug. Mein Vater brachte damals nicht so viel ein, trotz seiner Handwerkslehre, und meine Mutter hatte mehrere Putzanstellungen, um uns über die Runden zu bringen. Einfach war das nie für meine Eltern. Viel schuften, um zu leben. Aber so hart und so nah am Limit? Darüber dachte ich vor allem nach, während ich eine längere Zeit im Heim aufwuchs. Von außen betrachtet war vielleicht ich das ärmste Kind in meiner Klasse, aber ich glaubte, dass nicht mein Zuhause über meine Zukunftschancen entscheiden sollte. Denn immerhin bekam ich von meinen Ziehmüttern und -vätern viel Unterstützung hinsichtlich meiner persönlichen Entwicklung und meiner Schulbildung. Dank dieser verlief meine schulische Karriere im Rahmen des besseren Durchschnitts. Dass ich das Abitur machen konnte, sah also allgemein gut aus. Es ambitionierte mich dran zu bleiben und mein Bestes zu geben, um hoffentlich nach der Schule ein Studium beginnen zu können. Ja, ich wollte unbedingt an die Uni. Vieles konnte ich mir nämlich vorstellen: Fotografie (war das nicht mal ein Ausbildungsberuf?), Germanistik, Literatur, Psychologie, Stadtplanung, …, meine Neugier war groß. Hauptsache etwas lernen, womit ich a. einen sozialen Aufstieg zu erreichen wünschte, und b., womit ich etwas arbeiten könnte, was mir Spaß bereite, was meinen Interessen entspräche und womit ich mich irgendwie zu identifizieren wüsste.
Die Hoffnung auf ein Studium wurde mir für einige Wochen von der Landespolitik genommen. Ich erinnere mich gut daran, denn ich war 15 Jahre alt und es waren noch wenige Monate Zeit, bevor ich in die Oberstufe wechseln sollte. Dieser eine Tag war ein unbedeutender Wochentag gewesen, bis ich im Radio von den geplanten Studiengebühren in NRW erfuhr. Mir war als würde die eine, auch meinem Leben zugewiesene Seite der großen Schere plötzlich noch weiter nach unten klaffen. Wer sollte das bezahlen? Wie sollte ich jetzt meine Ziele erreichen? Wenn die Universitäten, Land für Land, zusätzlich der Semestergebühren nun auch noch mehrere hundert Euro pro Halbjahr für einen Studienplatz verlangen durften und diese dementsprechend erst einmal den reichen Kindern vorbehalten würden, hätte ich überhaupt noch irgendeine Chance? Mich frustrierte die Aussicht ungemein. Zwangsweise dachte ich darüber nach, ob mir nicht auch ein Ausbildungsberuf genügen könnte. Eher nicht, denn jeder Überlegung folgte, dass a. oder b. auf jeden Fall einander ausschließen würden. War ich ein „naives Mädchen“? Nur weil ich lieber in einer Gesellschaft leben wollte, in der ich nicht nur solche Optionen für mein Leben wähle, die mir als Auswahl zu Verfügung gestellt werden, solange ich doch bitte das nötige Kleingeld dafür zahle. Sondern weil ich uns eine wünsche, in der ich wähle, was ich will, unabhängig der beruflichen oder finanziellen Lage meiner Eltern? Nein. Ich wollte jetzt erst recht nicht aufgeben. Aus der anfänglichen Frustration wurde Wut und darüber hinaus entwickelte sich noch rechtzeitig – entschuldigt den schlechten Reim – der Mut. Nein, es folgt kein Happy End im klassischen Sinne. Nach einigen größeren und kleineren Steinen habe ich mit 27 Jahren mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Ich bin sogar noch in den mittleren Durchschnitt gerutscht, wow! Und nun?
Nun, am Dienstagabend um 23 Uhr, sitze ich in Berlins größter Bibliothek und arbeite an meiner ersten Hausarbeit, die natürlich schon bald Abgabetermin hat. Um mich herum viele andere Menschen jeder Klasse, alle fleißig, manche auch unter leichtem Druck. Was ich denn studiere? Also, Medizin überlasse ich denen, die es wollen – ich studiere Europäische Ethnologie. Was, Sie denken ich bleibe damit bestenfalls in der Arbeiterklasse? Na, dann habe ich wenigstens Spaß dabei.