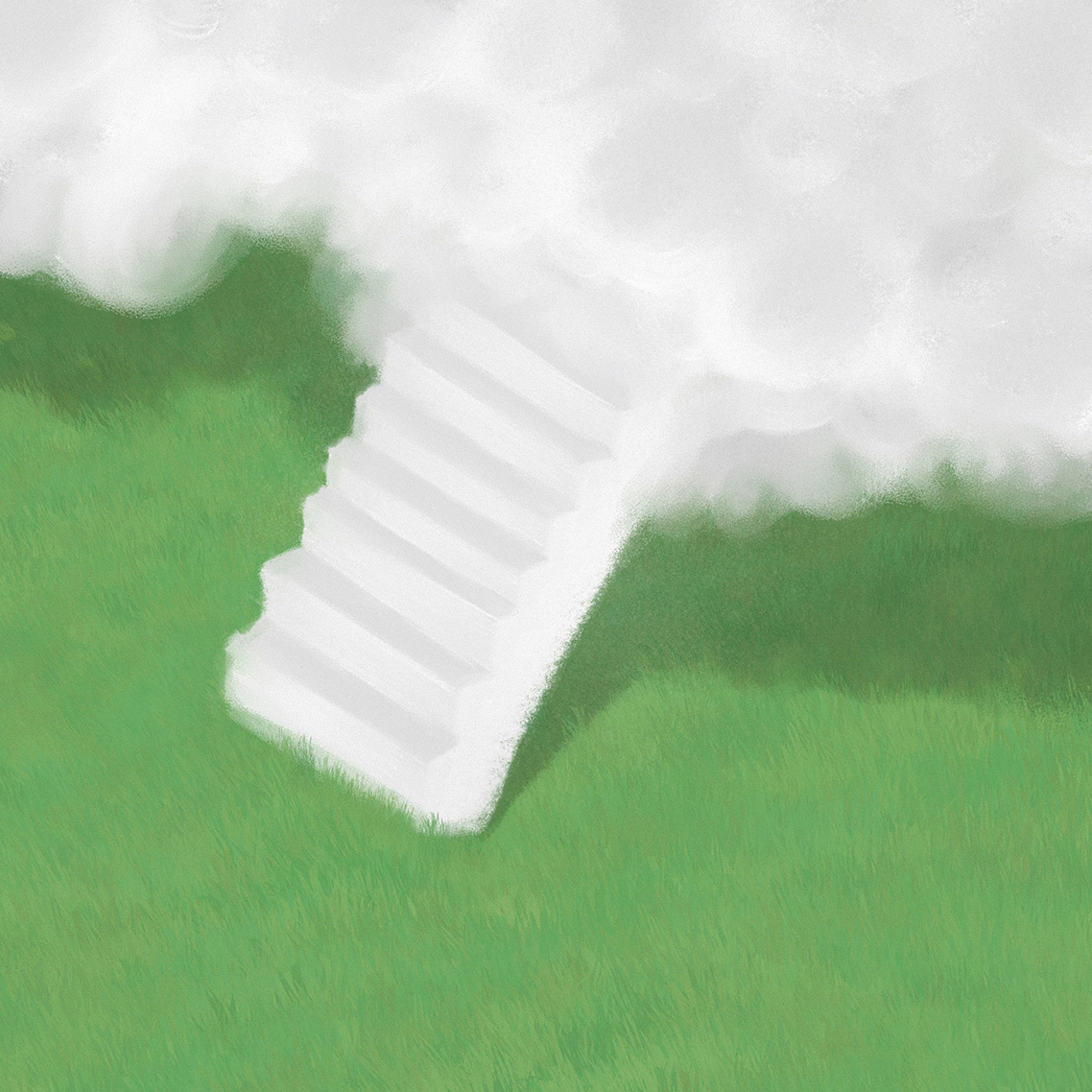
Aufstiegsängste
Das sogenannte „Hochstapler-Syndrom“ unter Erststudierenden. Von Svea M. Schnaars.
Nicht selten wird, wenn es um gesellschaftliche Spaltungen geht, von den angeblichen „Abstiegsängsten“ der Wohlhabenden gesprochen. In der Regel werden diese sogar als Rechtfertigung für jegliches unsolidarisches Verhalten herangezogen. Deutlich weniger verständnisvoll hingegen werden die Ängste von weniger gut situierten Personen behandelt. Gerade für Heranwachsende aus nicht-akademischen Familienhäusern werden vielmehr „Aufstiegsängste“ erkenntlich, sobald sie höhere Bildungsgrade als ihre Eltern anstreben. Mängelgefühle, Selbstunterschätzung und ständiges Vergleichen mit anderen sind unvermeidbar in einem Umfeld, in dem die Meisten idealere Voraussetzungen hatten als man selbst.
Bildungswege sind von Weggabelungen geprägt: von Noten, von der Spannweite zwischen Hauptschule bis Gymnasium, von den Ressourcen der Privatschulen im Kontrast zu denen der öffentlichen Schulen und letztlich von den daraus resultierenden Entscheidungen für Karrierelaufbahnen. Schülerinnen sind jedoch bereits vor dem Antritt dieses Weges unterschiedlich für die Reise ausgestattet.
Der Bildungshorizont von Jugendlichen ist maßgeblich von ihren Familienverhältnissen bestimmt. Auch die Empirie spricht dafür – in Deutschland bestreben laut dem Abschlussbericht des Hochschul-Bildungs-Report für das Jahr 2022 circa 79 Prozent der Akademikerinnenkinder ein Studium und 64 Prozent schließen auch erfolgreich den Bachelor ab. Unter den Kindern aus nicht-akademischen Haushalten versuchen sich lediglich 27 Prozent an einer Hochschullaufbahn und 20 Prozent erhalten einen Bachelorabschluss. Dieser Trend zeichnet sich in den höheren Abschlüssen weiter ab. Bei Promotionsabsolventinnen lässt sich sogar eine Differenz von 6 Prozent der Akademikerinnenkinder zu 2 Prozent der Nicht-Akademiker*innenkinder herauslesen (vgl. Abschlussbericht des Hochschul-Bildungs-Reports 2020: 13).
Doch selbst wenn trotz aller Hürden ein akademischer Aufstieg gelingt, bleibt für viele Grenzgängerinnen ihr Erbe spürbar. Sie sind häufig von Zweifeln geplagt, fühlen sich entfremdet von ihrem Umfeld, müssen viel Eigeninitiative aufbringen und unterschätzen ihre bisherigen Erfolge. Einige entwickeln derartig starke Minderwertigkeitsgefühle, dass sich die Vorstellung festsetzen kann, eine Hochstaplerin zu sein, welcher nur durch Zufall oder unterbewusste List an ihre jetzige Position gelangt ist.
Das sogenannte Hochstapler-Syndrom (engl. „Impostor-Syndrome/-Phenomenon“), von dem im Folgenden die Rede sein wird, ist ein noch recht junger Forschungsgegenstand. Erstmals wurde der Begriff von den US-amerikanischen Psychologinnen Pauline R. Clance und Suzanne A. Imes im Kontext einer Befragung von weiblichen Akademikerinnen unterschiedlicher Fachrichtungen und akademischer Grade eingeführt, die speziell die persönliche Einschätzung ihrer bisherigen Karriereerfolge analysierte. Aus ihrer Studie ergab sich, dass erfolgreiche Frauen von starken Selbstzweifeln besonderer Art geplagt sind (vgl. Clance/Imes 1978: 241-242).
Demnach fallen diese Selbstzweifel derartig drastisch aus, dass jegliche Erfolge ausschließlich äußeren Faktoren zugeschrieben werden. Es manifestiert sich die Vorstellung, das System „betrogen“ zu haben, seine jeweilige Position also nicht verdient zu haben. Sich, wortwörtlich, als „Hochstaplerin“ im Bezug zu den eigenen Erfolgen wahrzunehmen (ebd.: 241).
Betroffene hätten jedoch lediglich das Gefühl der Hochstapelei, ihre Kompetenzen und Qualifikationen ließen sich auf zahlreiche Weise von Leistungen bestätigen. Sie würden daher ohne tatsächliche Begründung stetig befürchten, dass ihre „Fassade“ aufgedeckt werden könne (vgl. Klinkhammer/Saul-Soprun 2009: 165).
Meine Recherchen ergaben, dass neben Frauen insbesondere Personen mit Migrationsgeschichte (umso mehr, wenn sie nicht als weiß gelesen werden) und solche aus nicht-akademischen Haushalten eine Tendenz zum Hochstapler-Syndrom haben. Zudem verstärkt sich der Effekt bei Intersektion dieser Identitätsmerkmale.
Dem ist so, da sie nicht der Dominanzkultur der Hochschulen entsprechen. Bei Frauen* schüren die weibliche Sozialisierung, stark gegenderte Berufsfelder und die sexistischen Erwartungshaltungen ihnen gegenüber diese Aufstiegsängste (vgl. Clance/Imes 1979: 242-243). Die Migrationsgeschichte wirkt diesbezüglich durch die Komplexität von Mehrsprachigkeit, Rassismuserfahrungen und dem Minderheitsdasein als entfremdend (vgl. Noble 2013: 349-351). Die Auswirkungen der Bildungs- herkunft machen sich in den fehlenden materiellen wie auch intellektuellen Ressourcen bemerkbar – um es mit der Kapitaltypologie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu auszudrücken: mit ökonomischem, sozialem, kulturellem und symbolischem Kapital. Das Ansammeln dieser Kapitale lässt sich über Generationen hinweg zurückverfolgen.
Die Besonderheit der bourdieuischen Theorie ist, dass sich Kapital in vier Formen äußert. Ökonomisches Kapital besteht klassischerweise aus finanziellen und materiellen Ressourcen. Diese Kapitalform ist in der Regel die Wurzel aller anderen Kapitale. Durch Investitionen könne sie somit in kulturelles, soziales und symbolisches Kapital umgewandelt werden. Alle Kapitalformen sind unter gewissem Aufwand ineinander umwandelbar und voneinander abhängig (vgl. Bourdieu 1986: 15, 24).
Kulturelles Kapital ist kurzgefasst die Bildung und die Fähigkeiten, die mit ihr verbunden sind. Soziales Kapital stellt die einflussreichen Beziehungen einer Person dar und symbolisches Kapital manifestiert sich in Titeln und öffentlicher Anerkennung (vgl. ebd.: 17-25).
Leichter und beispielhaft formuliert ist Bourdieus Ansatz sehr einleuchtend: Wer viel Geld hat, kann sich gute Bildung leisten. Wer sich gute Bildung leisten kann, gewinnt Einfluss und Zugang zu exklusiven Kreisen. Wer Einfluss hat und sich in exklusiven Kreisen aufhält, erhält gesellschaftliche Anerkennung. Wer all dies hat, wird vermutlich auch gut verdienen – der Kreislauf wiederholt sich und wird an die nächste Generation vererbt.
Besitzt man jedoch weniger von einem dieser Kapitale und muss sich dieses selbst erarbeiten, wird das Fremdsein immer wieder bewusst gemacht. Bildungsaufsteiger*innen berichten oftmals von diesem Gefühl, ohne es erklären oder benennen zu können, wie auch der deutsche Soziologe Aladin El-Mafaalani in seiner Forschungsarbeit „Bildungsaufsteiger-Innen aus benachteiligten Milieus“ feststellte (vgl. El-Mafaalani 2012: 317). Viele bewältigen dies nur durch Gewöhnung und Schaffung neuer Handlungsmöglichkeiten im Rahmen ihres zugeschriebenen Andersseins.
Die Gesamtheit der Kapitale, mit denen man aufwächst, nennt Bourdieu „Habitus“. Dieser spalte sich durch den Eintritt in ein unbekanntes Feld (vgl. Jurt 2010: 11).
Anita Barkhausen bemerkte in ihrer Arbeit, dass Marginalisierte häufig nicht nur wenig einflussreiches soziales Kapital besäßen, sondern gar ein negatives Sozialkapital. Ihre Beziehungen würden aufgrund ihrer Stigmatisierung sogar teils einschränkend für ihre Karrierelaufbahn wirken. Als Konsequenz müssen diese Kontakte abgebrochen werden oder man sähe sich zumindest gezwungen, sich von ihnen zu distanzieren. Dadurch entstünde ein Gefühl der „Doppelten Fremdheit“ – einerseits durch den Eintritt in ein fremdes Feld und andererseits durch den Verlust der frühesten Habitus-Umgebung (Barkhausen 2020: 171).
All dies verweist auf Zusammenhänge zwischen marginalisierter Identität und den Spannungen zwischen ihrem Habitus und dem akademischen Feld. Diese Spannung bietet strukturelle Rahmenbedingung für die Symptomatik des Hochstapler-Syndroms. Je nach marginalisierter Gruppe sind wiederum facettenreiche Umgangsarten und Ausdrücke dieser emotionalen Last erkennbar.
Diese Irritationen werden in den hier gewählten Publikationen unterschiedlich benannt, doch die Überschneidungen der beschriebenen Situationen sind unübersehbar. El-Mafaalani spricht von einer Irritation des Ursprungshabitus, die zu einem phasenhaften Wandelprozess unter Bildungsaufsteiger*innen führen kann. Währenddessen verweist der australische Historiker Greg Noble auf die Charakteristika eines ethnisierten Habitus und seiner „inside outness“. Aufgrund der Formung durch den Ursprungshabitus wird nie eine vollständige Metamorphose geschehen. Die Anpassungsbemühungen können jedoch einen gesunden Umgang mit dem Fremdsein generieren, wie El-Mafaalani sie beschrieben hat. Es kann sich dabei andernfalls auch, wie bei Noble, um einen unermüdlichen Aushandlungsprozess mit dem Selbst handeln. Das Hochstapler-Syndrom stellt wiederum eine pathologische Reaktion auf das Nicht-Passen dar.
Als Studierende erster Generation müssen wir uns häufig mit Anzeichen des Hochstapler-Syndroms auseinandersetzen. Als das beste Gegenmittel erwies sich für mich stets das Schaffen eines Bewusstseins hinsichtlich meiner eigenen Herkunft und ein Loskoppeln von jeglicher Scham diese betreffend. Durch mein Studium und mein Engagement erkannte ich auch viele Stärken, Spezialfähigkeiten und Sensibilitäten, die ich aus eigener Kraft heraus durch den Grenzübergang gewann. Zwar wünsche ich mir eine Gesellschaft, in der dieser Vorgang weniger schmerzhaft und notwendig ist, doch zumindest die Sichtbarmachung all dieser Erfahrungen ermächtigt uns dazu, das Wort im Angesicht solcher Ungerechtigkeiten zu erheben.
Literaturverzeichnis
Barkhausen, Anita (2020): Lebenslänglich (…) auf Bewährung. Zur strukturell bedingten Verschuldung von Wissenschaftler*innen. In: Femina Politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft, 1, 169-174.
Bourdieu, Pierre (1986): The Forms of Capital. In: Richardson, John (Hrsg.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood, 241-258.
Bourdieu, Pierre (2004): Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978): The Imposter Phenomenon in High Achieving Women. Dynamics and Therapeutic Intervention.In: Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 15(3), 241-247.
El Mafaalani, Aladin (2012): BildungsaufsteigerInnen aus benachteiligten Milieus. Habitustransformation und soziale Mobilität bei Einheimischen und Türkeistämmigen. Wiesbaden: Springer VS.
Hochschul-Bildungs-Report (2022): Abschlussbericht 2022. URL: https://www.stifterverband.org/medien/hochschul-bildungs-report-2020-bericht-2019 (zuletzt abgerufen: 27.03.23).
Jurt, Joseph (2010): Die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie, 3, 5-17.
Klinkhammer, Monika; Saul-Soprun, Gunte (2009): Das „Hochstaplersyndrom“ in der Wissenschaft. In: Organisationsberatung Supervision Coach, 16, 165-182.
Noble, Greg (2013): It is Home but it is not Home. Habitus, Field and the Migrant. In: Journal of Sociology, 49 (2–3), 341-356.
Illustration: 愚木混株 Cdd20



