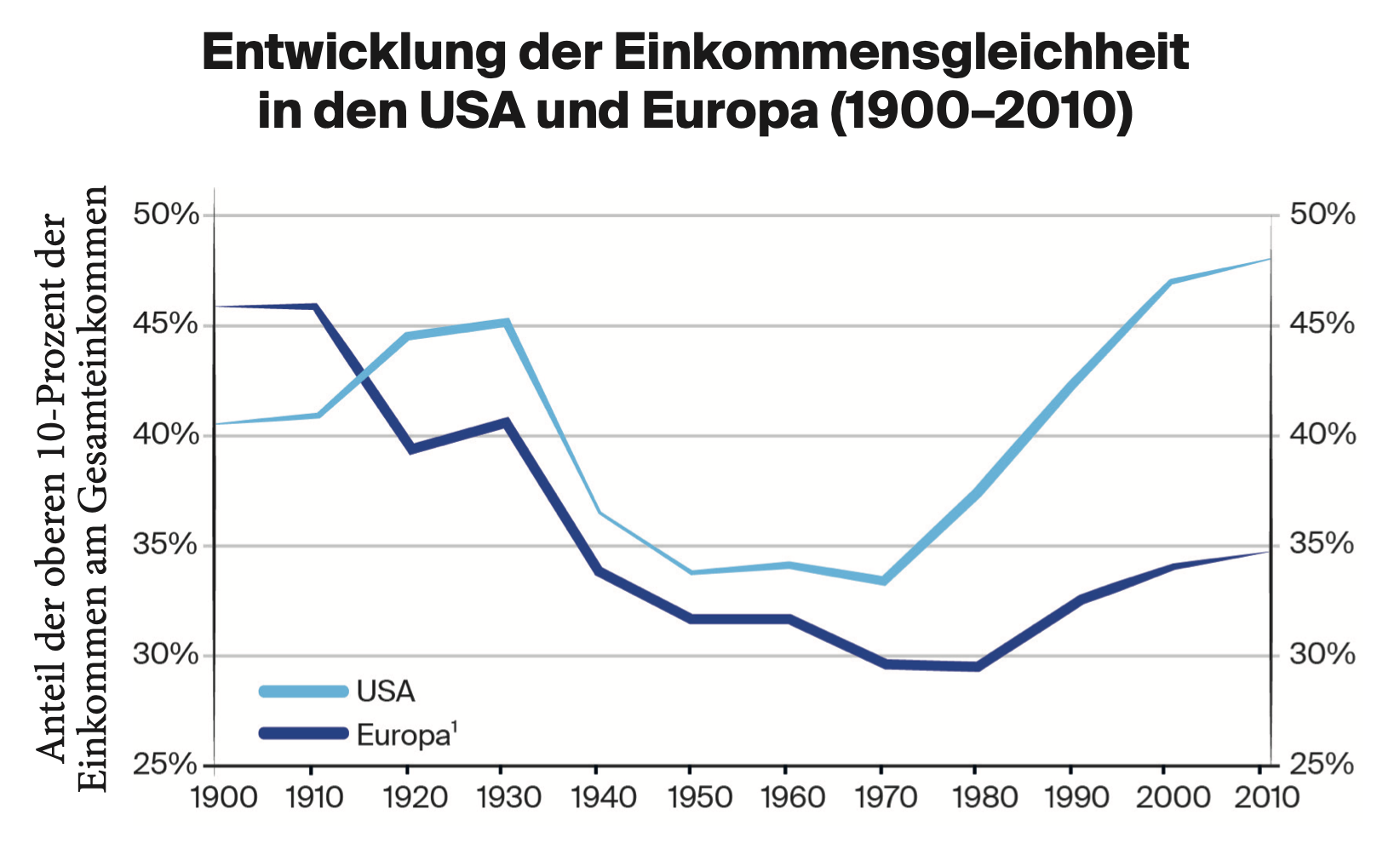Der Pennymarkt in mir – oder wieso sich die Kultur an Universitäten ändern muss
Von Bilke Schnibbe
Bevor ich an die Universität gegangen bin, wusste ich nicht, was die Universität ist. Ehrlich gesagt, wusste ich bis zu Beginn der 12. Klasse auch nicht genau, was das Abitur ist. Meine Eltern hatten beide einen soliden Realschulabschluss und sind Bauer und Teilzeit-Sachbearbeiterin beim Landkreis. Die wussten eigentlich auch nicht genau, was die Universität ist, glaube ich. So viel haben wir uns nie darüber unterhalten. Unser Schlachter, Onkel Ferber, hat immer gesagt, mein Vater solle uns Kinder lieber nicht auf das Gymnasium lassen, weil wir dann nicht am Hof bleiben würden. Er hatte recht. Mittlerweile bin ich Psychologin und arbeite in einer Klinik in Berlin.
Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Moment zu Beginn meines Studiums, als mich zwei linke Studien-Freundinnen zuhause besuchten. Sie standen vor meinem Kühlschrank und griffen einzelne Produkte heraus, die ich allesamt im Penny-Markt gekauft hatte und amüsierten sich. Sie lachten darüber, dass überhaupt irgendein Mensch ein Stück Gouda kauft, das eine Plastikrinde hat. Ich begriff erst Jahre später, was das Unbehagen zu bedeuten hatte, das ich in dieser und vielen anderen Situationen spürte. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Es hat gedauert bis ich mir klar wurde, dass ich mich nicht auslachen lassen muss für das, was ich esse, Schlagermusik und die Tatsache, dass bei meinen Eltern keine tiefschürfenden Bücher im Regal standen. Ich spürte dieses Unbehagen auch in den Gruppen, in denen ich mich hochschulpolitisch zu engagieren versuchte. Mal ging es um ein „veganes Aufstrichkollektiv“, mal um die Wichtigkeit von „Freiräumen“, dann wieder um „was Marx schon sagte“. Oder Adorno. Ich hätte es damals nicht zugegeben, aber eigentlich wusste ich bis zum Ende meines Studiums nicht ganz genau, was es mit Aufstrich, Freiräumen und Namedropping irgendwelcher Philosoph_innen auf sich hat. Meine größte Sorge war, dass irgendwer herausfindet, dass mein Vater in unserer Gemeinde stellvertretender CDU-Bürgermeister war.
Das klingt so, als wollte ich mich lustig machen. Ich gestehe, eine gewisse Situationskomik hat es mittlerweile schon für mich, wenn Anfang Zwanzigjährige flammende Reden über Linsenpaste halten. Aber es ist trotzdem nicht mein Anliegen, das lächerlich zu machen. Mir geht es darum zu hinterfragen, wie es eigentlich sein kann, dass Menschen ohne Eltern, die studiert haben, jahrelang nur Bahnhof verstehen, wenn es um linke Ideen und Projekte geht und sich nicht trauen nachzufragen. Und das während alle Leute beklagen, dass linke Themen in linken, akademischen Blasen verhallen, obwohl sie doch so sehr im Interesse der Leute wären.
Meine Erfahrung ist, dass sich in der Uni alle in die Hosen scheißen. Insbesondere in den ersten Semestern. Bloß nichts falsch machen, sich bloß nicht blamieren und in linken Gruppen bloß nichts Falsches sagen und keine dumme Frage stellen. Die erste Politgruppe, in der ich an der Uni war, war regelmäßig damit beschäftigt in einem Keller zu sitzen und sich zwei Stunden anzuschweigen. Kein Witz. Dieses Gefühl, dass alle mehr wissen als man selbst, bezieht sich nicht nur auf Kinder aus nicht-akademischen Elternhäusern, sondern in gewissen Grad auf alle, die irgendwo zu studieren anfangen. Ich glaube aber, dass Studierende aus akademischen Elternhäusern schneller lernen, was eigentlich Phase ist in den Seminaren und in ihren Politgruppen. Ganz plump formuliert könnte man sagen, dass ich einfach keine Person kannte, die studiert hatte und mit der ich meine Unsicherheiten hätte besprechen können. Ganz im Gegenteil, in meiner Familie herrschte eher Unverständnis für das vor, was ich da tat. Auch wenn meine Eltern sich die größte Mühe gaben mich finanziell zu unterstützen, ich hätte ihnen gegenüber niemals freiwillig zugegeben, dass ich eigentlich gar nicht wusste, was ich da tue. Und Props für linkspolitisches Engagement gab es schon mal gar nicht (Stichwort stellvertretender CDU-Bürgermeister). Ich kannte also noch viel weniger eine Person, mit der ich meine Unsicherheiten mit linken Inhalten hätte diskutieren können.
Um diese Dynamik wirklich zu durchbrechen müsste sich an der „Kultur“ an Universitäten etwas ändern. Sich als besonders intelligent und gebildet darstellen müssen ist etwas, das ich aus meinem Herkunfskontext so nicht kenne. Und so dankbar ich für meine Bildung bin – darauf hätte ich verzichten können. Der Zwang abzuliefern in allen Bereichen und sich bloß keinen Fehler zu leisten ist ein Verhaltensmodus, der Studierende aus nicht-akademischen Kontexten benachteiligt. Auch in linken Zusammenhängen kommt dies zum Tragen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass intellektuelle Auseinandersetzung als die Königsdisziplin linker Arbeit gilt. Oder wenn es nur darum geht, dass Leute, die bei Penny einkaufen lächerlich und/oder ignorant sind. Mir geht es auch hier nicht darum zu sagen, dass Theoriearbeit ein Witz und Penny ein guter Laden sei, ganz und gar nicht. Aber ohne selbstherrliche, sozialchauvinistische Einstellungen abzulegen, wird es schwierig werden, über die eigene Blase hinauszukommen und gute linke Ideen und Einstellungen unter andere Menschen zu bringen, als die, die das eh schon so sehen.
Bilke Schnibbe. Proletin, Psychologin und Autorin für unter anderem FICKO -Magazin für gute Sachen. und gegen schlechte und ihren eigenen Blog (bilkdrei.wordpress.com/).