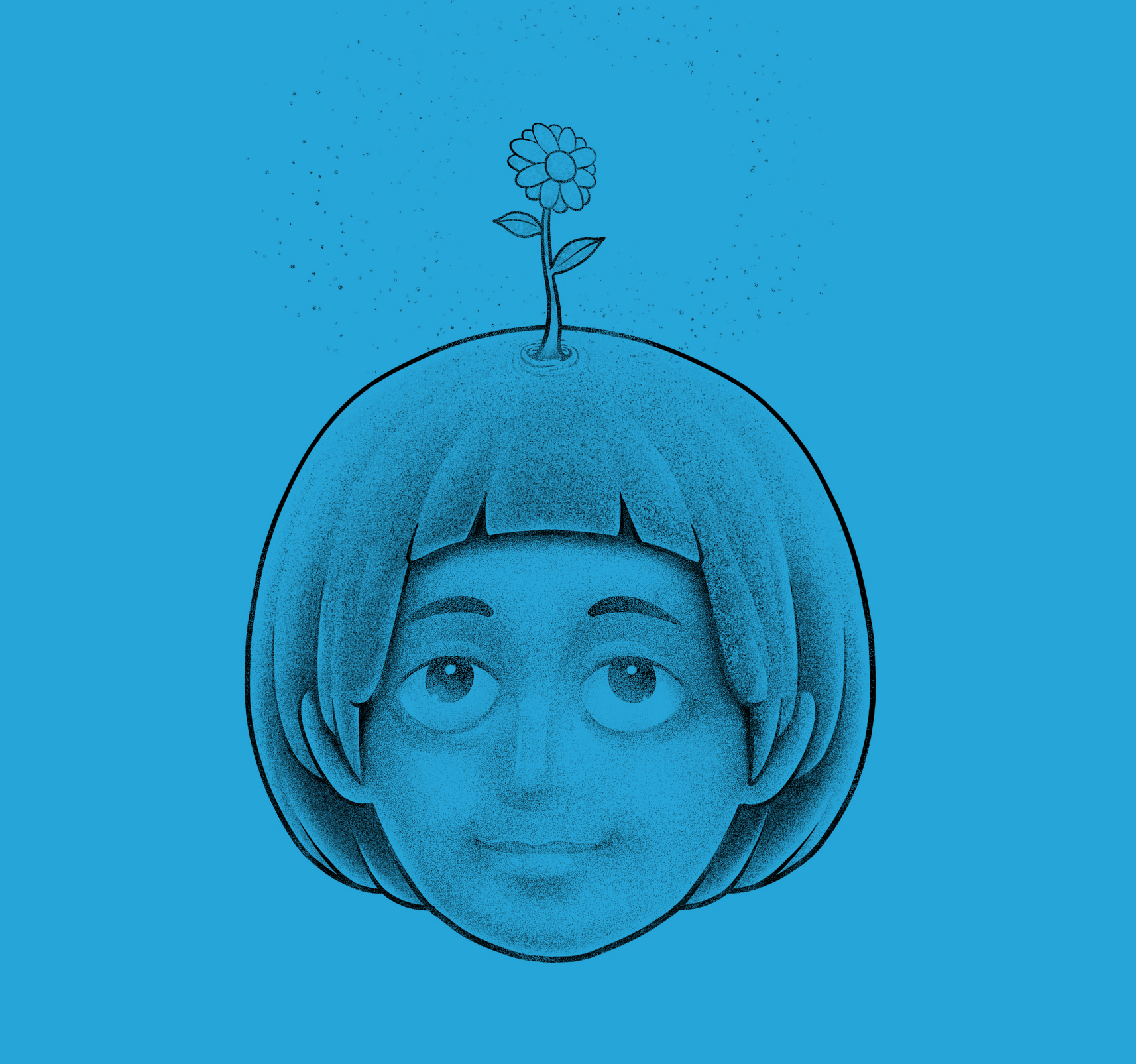Wo sind die armen Menschen?
Über Repräsentation und Verklärung von Armut in Serien von Silvia Klein
Ich bin 14 Jahre alt und während meine damals beste Freundin auf Familienurlaub ist, spiele ich in ihrer Wohnung Katzensitterin. Es ist die Zeit, in der Netflix gerade von einem DVD-Ausleihservice zu einem Streamingservice geworden ist und als Kind von Eltern, die ein Limit auf Fernseh- und Internetzeit legen, genieße ich diese Nachmittage nicht nur der Katze wegen, sondern auch weil ich den Rest der Zeit die Erlaubnis habe, den Netflix-Account zu verwenden.
Ich zappe durch einige Sitcom-Folgen bis ich bei ‘2 Broke Girls’ lande, damals noch relativ neu. Die Serie verfolgt das Leben von Max, einer Kellnerin mit geringen finanziellen Mitteln, und Caroline, ehemalige Milliardärin, die ihr Vermögen verliert, nachdem ihr Vater wegen krimineller Aktivitäten verhaftet wird und nun zum ersten Mal auf eigenen Beinen steht. Die beiden Frauen sind erst Kolleginnen, dann Mitbewohnerinnen und werden schließlich Freundinnen und Businesspartnerinnen. Max zeigt Caroline, wie man in Brooklyn überlebt, Caroline zeigt Max, dass sie nur an sich glauben muss, um ihren Traum von der eigenen Cupcake-Bäckerei wahr werden zu lassen. Das Ganze wird begleitet von vielen Witzen über Sex, Ethnien und Armut, inklusive problematischer Vorurteile gegen arme Menschen – doch dazu später mehr.
Als ich die Serie das erste Mal sehe, bin ich begeistert. Ich bin noch zu jung, um den Humor einzuordnen oder zu verstehen, was Klassismus bedeutet. Stattdessen sehe ich, dass einmal ein Charakter im Vordergrund steht, der kein glamouröses Leben lebt. Max ist tough, stark, unabhängig, witzig – und sie hat Geldprobleme.
Ich hatte in meiner Jugend nicht das Gefühl, in Armut zu leben, aber ein spürbarer Unterschied zu meinen Klassenkamerad*innen, auch zu meiner besten Freundin, war da. Die Serie vermittelte den Eindruck, dass kein Geld zu haben gar nicht so schlimm war. Man musste nur erfinderisch sein und ein paar Freund*innen haben, mit denen man gemeinsam litt, alles mit Humor nehmen und schon war es machbar. Das gab mir ein Gefühl von Hoffnung und Normalität, im Vergleich zu anderen Serien der Zeit, in denen Geld entweder kein Thema war oder die Charaktere allesamt der High Society entstammten.
Jetzt, zehn Jahre später, tippe ich für meine Recherche für diesen Artikel ‘Serien über Armut’ in die Suchleiste meines Browsers ein. Die Ergebnisse sind spärlich. Auf einer Website wird mir Breaking Bad vorgeschlagen. Es ist schon eine Weile her, dass ich diese Serie gesehen habe und in gewisser Weise ist die mangelnde Gesundheitsversorgung in den USA und somit der finanzielle Status zwar der Ausgangspunkt der Geschichte, das Thema aber meiner Meinung nach ein anderes. Schließlich stoße ich wieder auf ‘2 Broke Girls’.
Also gut, dann auf zu einer Reise in die Vergangenheit. Ich erinnere mich nicht an viel, außer an das beschriebene wohlige Gefühl vor dem Fernseher meiner Kindheitsfreundin. Neugierig beginne ich die ersten Folgen zu streamen. Ich habe nämlich den Verdacht, dass sich im Nachhinein viele Witze als nicht witzig und viele Darstellungen als problematisch entpuppen werden, wie mir das bereits mit einigen anderen Sitcoms passiert ist.
Leider bestätigt sich meine Befürchtung. Über Humor kann man bekanntlich streiten, spätestens als ein Spruch darüber fällt, dass bisexuelle Menschen sich nicht entscheiden können, bin ich aber raus. Viele der Witze zielen darauf ab, wie gefährlich Brooklyn ist, wie wenig Selbstwertgefühl Max hat und welche Dinge sie bereits dank ihrer Armut getan hat oder wie eklig/sexuell übergriffig/drogenabhängig arme Menschen seien. Dazu runzle ich mir mehrmals die Stirn, wenn sich Max und Caroline, obwohl sie ständig darüber reden, wie wenig Geld sie haben, jeden Tag Kaffes to Go oder frisch gepresste Säfte leisten. Das soll nicht heißen, dass arme Menschen kein Recht darauf haben, sich derartige Produkte zu kaufen und das nicht auch manchmal tun – aber ich persönlich kenne niemanden mit Geldproblemen, für den dies alltäglich ist.
Letztendlich bleibt ein fahler Beigeschmack, dass es Caroline ist, die Milliardenerbin mit einem Abschluss von der Business-School, die es braucht, damit Ordnung und Ehrgeiz in Maxs Leben kommt. Immer wieder fallen Sätze, wie dass Max nur an sich selbst glauben müsse, um ihre eigene Bäckerei zu starten und der Armut zu entkommen. Dementsprechend überrascht es mich überhaupt nicht als ich herausfinde, dass eine der beiden Schaffer*innen der Serie Tochter eines Venture Capitalists ist.
Das war wohl nichts mit der Repräsentation von Armut, auch wenn es mir als 14 Jährige noch anders vorkam. Im letzten Jahrzehnt scheint sich dahingehend leider auch nicht viel getan zu haben. Arme Menschen in den Medien sind entweder der Comic Relief, auf deren Kosten Witze gemacht werden, oder sie sind die Protagonist*innen von Reality-TV, damit wir ihnen zusehen und uns dabei besser fühlen können. Was auch zu beobachten ist, ist eine unglaubliche Romantisierung von Armut und Leid im Allgemeinen. Man denke nur an das Narrativ der Held*innen, die unterbezahlt im Gesundheitswesen arbeiten. Lieber wird ihr Job verklärt, als dass tatsächlich etwas an der Bezahlung und den Arbeitsbedingungen verändert wird. Dann wäre da noch der ‘struggling Artist’ und die Idee, dass Kunst aus Leid entsteht und es heroisch ist, für die Selbstverwirklichung alles aufzugeben. Ich glaube, meine Kunst wäre deutlich besser, wenn ich mich nicht nebenbei mit Existenzfragen herumschlagen müsste. Alleine schon deshalb, weil ich viel mehr Zeit für sie hätte.
All das ist schade, denn eine ehrliche, unromantisierte und dreidimensionale Darstellung von Armut und armen Menschen in Geschichten, egal in welchem Format, wäre wichtig. Um Vorurteile abzubauen (oder zumindest keine weiteren Stereotypen zu reproduzieren), um Aufmerksamkeit zu schaffen oder einfach damit sich auch diese Menschen in Charakteren wiederfinden. Denn wer hätte es gedacht – auch arme Menschen sind Menschen, die es verdient haben, einen Platz in der Gesellschaft und ihren Geschichten zu finden.